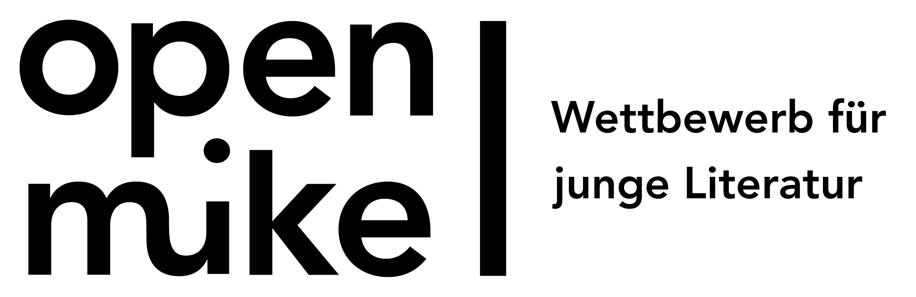David Hugendick ist Literaturkritiker von ZEIT ONLINE und hat ein Problem mit Berlin-Romanen. Im Interview erzählt er, warum er den Namen Luna nur noch bedingt lesen kann, wie es junge Debüts in die Feuilletons schaffen und warum sich die Literaturkritik nicht selbst überschätzen sollte.
Literaturproduktion IV
Literaturkritik ist eine Stimme im Gespräch über Literatur
open mike blog: „Alle Figurennamen der jüngsten deutschen Literatur zusammen könnten auch eine Kita-Gruppe im Prenzlauer Berg ergeben.“ Kommt dir das bekannt vor?
David Hugendick: (lacht) Ja, das hab ich geschrieben.
Stimmt, und zwar letzten November unter dem #openmike24 auf Twitter. Was hat es damit auf sich?
Ach, das war nur ein Scherz. Mir fiel nur auf, dass es in der jüngeren deutschen Literatur ein wenig in Mode ist, den Figuren übertrieben ausgefallene Namen zu geben. Luna oder Marla und so weiter. Das ist an sich natürlich völlig in Ordnung. Manchmal ballt es sich nur so sehr, dass ich mir einen Uwe, eine Gisela oder einen Dieter wünsche. Ich befürchte nur, dann würden manche dieser Geschichten gar nicht mehr funktionieren.
Das scheint dich zu beschäftigen. Erst kürzlich hast du in der Besprechung von Philipp Winklers Hool die Namen der Figuren herausgestellt – da waren es Axel und Ulf. Die mussten aber auch so heißen, oder?
Genau. Ich will gar nicht mit dem Wort „authentisch“ anfangen, das ist ja so ein leerer Modebegriff, der inzwischen auch schon das Gespräch über Literatur erfasst hat. Sagen wir lieber: Ich muss einer Geschichte glauben können. Eine Geschichte, in der die Figuren Luna oder so heißen, ist allerdings nicht unbedingt unglaubwürdig. Namen zeigen ja möglicherweise nur ein gewisses Milieu an, aus dem die Geschichte erzählt wird oder eben, in das die Geschichte hineinwirken will. Wenn alle Figuren aber heißen wie geheimnisvolle Eckensteher an Kunstakademien werde ich etwas stutzig. Das ist natürlich total kleinkariert. Vielleicht habe ich einfach einen leichten Überdruss an dieser Sorte Berlin-Roman, in dem alle immer sehr traurig sind, in Fabriketagen oder Disko-Klos herumstehen und zu großgeratene Sätze sagen.
Das Authentische hat für dich im literarischen Diskurs also nichts zu suchen.
Ich finde das Wort schwierig, weil ja Literatur im besten Fall ein Kunstwerk meint. Ein Kunstwerk ist künstlich, also gemacht, es hat einen Autor, eine Form, hoffentlich eine Intention. Mich stört, dass zuletzt häufiger das Authentische gegen das Künstliche ausgespielt wird, als sei künstlich ein Schimpfwort. Als ginge es hier um das „echte Leben“ wie in einer Sozialreportage, beziehungsweise nur um den Plot, der uns möglichst „echt“ vorkommen soll. In der Literaturkritik werden häufig dann Romane als besonders authentisch gelobt, wenn sie aus einem dem*der Kritiker*in fremden Milieu kommen. Dieses Straßenmilieu von Clemens Meyer zum Beispiel, in dem die Härte des Erzählten gewissermaßen als Gütesiegel herhalten muss, dass alles auch wirklich so ist. Ich schätze Clemens Meyers Bücher sehr, finde es aber zu wenig, in ihm nur den Autor zu sehen, der als Berichterstatter zu uns kommt, und mal erzählt, wie es „da draußen“ so zugeht. Es ist ja Literatur, und die besteht eben nicht nur aus Plot oder einem interessanten Sujet. Für mich geht es letztlich darum, ob eine Geschichte in sich stimmig erzählt ist, da lasse ich mir dann auch viel gefallen. Meinetwegen auch rückwärtsbehufte Einhörner oder Menschen, die unentwegt im Geiste Korbstühle arrangieren und dabei schweigend Pralinen essen.
Rückwärtsbehufte Einhörner sind wohl eher die Seltenheit, aber in deinen zehn Jahren bei ZEIT ONLINE hast du dennoch schon einige Bücher kommen und gehen sehen. Warum haben es junge Debüts so schwer, in die Feuilletons zu kommen?
Ich glaube, dass Problem für junge Autor*innen ist vor allem, dass es inzwischen einfach sehr viele Debüts gibt, die alle um die ohnehin schon knappe Aufmerksamkeit des Feuilletons konkurrieren. Viel mehr noch als vor fünf oder sechs Jahren. Einerseits ist das natürlich schön, andererseits wird es dadurch schwieriger. Dann ist es oft einfach Glück, ob ein*e Kritiker*in diesen Roman bemerkt und sagt, „den finde ich interessant“. Natürlich rutschen einem oft Dinge durch und manchmal, das wäre jetzt Selbstkritik, nimmt man manche Verlage leider oft stärker wahr als andere.
Dabei wisst gerade ihr als Redaktion ja um solche Umstände wie die geringere Sichtbarkeit von kleinen Verlagen. Trotzdem kommen viele der besprochenen Debüts aus den großen Häusern…
Das ist leider richtig. Wobei wir uns in der Online-Redaktion schon Mühe geben, auch Bücher kleinerer Verlage zu besprechen. Es gibt natürlich auch kleine Verlage, die sehr interessante Bücher veröffentlichen und bei uns vorkommen – der Verbrecher Verlag oder mairisch zum Beispiel. Aber man kann da keine Regel aufstellen, keine Quote. Außerdem veröffentlichen kleinere Verlage einfach eine viel geringere Zahl an Büchern und die müssen den Kritiker*innen erst einmal positiv oder auf interessante Weise negativ auffallen. Es bringt ja auch nichts, ein Debüt in einem kleinen Verlag einfach mal so zu verreißen, da hat keiner was davon. Dann lieber gar nicht.
Tut der Verriss eines Debüts weh?
Ich finde Verrisse generell nicht leicht, weil man bei allem Ärger, den man mit einem Buch haben kann, ja auch fair bleiben muss. Aber klar, hin und wieder geht es nicht anders. Allerdings finde ich dieses simple Niederprügeln häufig befremdlich. Ich stelle mir immer auch die Frage: Warum schreibe ich diesen Verriss überhaupt? Es muss mich schon etwas Grundsätzliches an dem Buch stören, das vielleicht sogar noch über das Buch hinaus eine Bedeutung haben könnte. Neulich hatte ich ein Debüt aus einem größeren Verlag auf dem Tisch und darin steckte zum Beispiel wieder diese zur Pose gewordene, habituelle Melancholie, die mich in letzter Zeit schon an anderen Romanen gestört hat.
Stichwort Luna?
Ja. Und das hätte man natürlich mit diesem Überdruss an habitueller Melancholie einfach so in den Boden rammen können. Aber da habe ich gedacht, eigentlich muss das nicht sein. Denn das tut mir dann schon Leid. Wobei die Frage ja auch immer ist, wie man das schreibt. Ich finde man muss keine Autor*innen – egal wer das ist – kategorisch vernichten.
Was ist denn leichter, verreißen oder loben?
Beides gleich schwer. Es ist schwer, sich nicht von der eigenen Begeisterung davontragen zu lassen, so dass man das Argumentieren bei all dem Loben vergisst. Und es ist schwer, einen guten Verriss zu schreiben, der nicht selbstgefällig ist. Es gibt ja viele Verrisse, in denen sich die Kritiker*innen an dem, was sie da gefunden haben, selbst berauschen. So was gefällt mir nicht. Wenn man wirklich einen Verriss schreiben will, dann lieber kurz und hart. Es sei denn, man will sich einmal grundsätzlich mit einem*r Autor*in auseinandersetzen.
Sind denn die Kriterien, die du an Debüts und gestandene Autoren anlegst, vergleichbar?
Ja und nein. Ich würde mit jungen Autor*innen bei einem Verriss vermutlich anders umgehen als mit gestandenen Autor*innen. Die Diskussion damals um Helene Hegemann, als man ihr das Plagiat vorwarf, fand ich zum Beispiel unverhältnismäßig. Sie war damals 17 und ja, sie hat dieses Buch in die Welt geschickt und ja, vielleicht war manches etwas unglücklich, aber ich habe die Aggression der Kritik im Verhältnis zur Sache nicht verstanden. Woher kommt die? Und muss man darüber wochenlang im Feuilleton diskutieren? Da kam übrigens auch wieder dieses Authentizitätsgejodel: Sie kann doch noch gar nicht im Berghain gewesen sein, wie kann sie dann darüber schreiben? Ja, meine Güte. Da wird Kritik dann wirklich albern.
In diesem konkreten Fall spielte womöglich auch ihre Prominenz oder die ihres Vaters eine Rolle.
Das weiß doch außerhalb Berlins schon keiner mehr! Ich finde das schwierig. Mich interessiert die Biografie eines Autors im Vorhinein nicht. Wenn man dann merkt, dass es im Buch Einschüsse der eigenen Biografie gibt, kann es vielleicht interessant werden. Aber grundsätzlich sollte das egal sein.
Einmal positiv gefragt: Was sind denn sprachliche oder inhaltliche Kriterien, die für dich ein Buch interessant machen?
Das lässt sich nicht so leicht sagen. Ich mag einen gewissen sprach-spielerischen Überschuss. Wenn jemand sprachlich etwas mehr will als die Abbildung der Wirklichkeit im Originalmaßstab. Péter Esterházy wäre ein prominentes Beispiel: Literatur, in der die Sprache mehr oder weniger eine Hauptfigur ist. Das heißt natürlich nicht, dass mich andere Töne gar nicht interessieren. Aber solche persönlichen Vorlieben – Sprache, Geschichte, Ton – hat jede*r Kritiker*in.
Und wie wird dann redaktionspolitisch entschieden, welche Bücher gemacht werden und welche nicht?
Normalerweise schauen wir die Vorschauen durch, und ich bekomme Vorschläge von freien Autor*innen. Und dann gibt es die Bücher, bei denen ich sage, das Buch müssen wir möglicherweise dringend oder leider machen. Aber ich lasse mir jeden Monat auch Platz für unbekanntere Autor*innen.
Dieses Müssen finde ich schon bemerkenswert. Einerseits verständlich, denn ihr habt ja als Presse auch eine Informationspflicht, andererseits ist diese Abhängigkeit aber auch erschreckend. Gibt es keine Möglichkeiten, sich davon zu lösen?
Ich finde das auch seltsam. Und ja, diese Möglichkeiten gibt es natürlich: Es gibt genügend Bücher, die wir bei ZEIT ONLINE nicht besprechen, obwohl sie „dran wären“, was immer das heißt. Dass man bestimmte Titel machen muss, hängt natürlich oft auch mit der Berühmtheit der Autor*innen zusammen. Die Leute fragen sich einfach: „Wie ist denn nun der neue Kehlmann?“Aber ich verstehe nicht, warum jeder große Autor auch so viele Wörter bekommt. Ich finde, dass man ein mittelmäßiges Buch von, sagen wir, Peter Handke auch kurz abhandeln kann.
In welcher Rolle siehst du dich denn als Literaturkritiker auf dem Lebensweg eines Buches?
Ich glaube, dass die Rolle der Kritiker*innen oft unterschätzt wird. Oft allerdings auch überschätzt. Es gibt ja sehr viele Bücher, die ohne die Literaturkritik Bestseller werden. Nun sehe ich es auch gar nicht als die Aufgabe von Kritik, Bestseller zu produzieren oder Bestseller zu verhindern. Aber ich glaube wirklich nicht, dass ein Verriss oder Lob von mir die Wahrnehmung eines Buchs völlig verändert.
Andererseits ist das Ignorieren ja auch ein Verhalten.
Natürlich. Ich finde kritisches Beschweigen oft auch richtig. Das könnte man auch öfter außerhalb von Literatur machen. Man könnte auch mal das Zeug, das die AfD so redet, öfter ignorieren. Aber die Frage war ja eine andere: Ich glaube man macht sich verrückt, wenn man sich andauernd danach fragt, was man für oder gegen ein Buch tut, ob der*die Autor*in oder der Verlag sich freut oder ärgert. Ich glaube auch nicht, dass die Kritik dazu da ist, Autor*innen zu machen. Letztlich bekommt man ein Stück Literatur und geht damit irgendwie um. Hubert Winkels hat einmal geschrieben: Die Literaturkritik ist die Begegnung von Kopf und Buch.
Dazu gehört sicherlich auch die eigene Voreingenommenheit.
Klar. Ich fände es versuchsweise ganz heiter, Rezensionsexemplare ohne Namen zu bekommen und zu lesen. Am Ende des Buches ist dann ein Feld, das man freirubbeln muss, und dort steht dann ein Code für eine Internetseite, auf der man zehn Fragen zum Buch beantworten muss, damit auch sicher ist, dass man es gelesen hat. Und dann erst findet man heraus, wer es geschrieben hat. Aber klar, natürlich ist man voreingenommen! Oft gibt es ja auch Kritiker*innen, die eine*n Autor*in schon sehr lange begleiten, und manchmal verfallen sie in die Pose des enttäuschten Liebhabers, der mit seiner Liebe abrechnet: „Der ist nicht mehr so gut wie früher.“ Das sind oft ganz seltsame Texte, die da entstehen. Nicht unbedingt schlecht, aber doch seltsam.
Bliebe die Frage: Was ist eigentlich Literaturkritik und für wen ist sie gedacht?
Literaturkritik hat einen gewissen Servicecharakter für die Leser*innen, von denen ja zu Recht viele einfach wissen wollen: Soll ich das nun lesen oder lieber nicht? Aber zunächst ist die Kritik einfach eine Stimme in einem Gespräch über Literatur. Eine exponierte Stimme im literarischen Diskurs, an dem sowohl die Verlage, das Buch, die Buchhändler und die Leser*innen, als auch die Kritiker*innen teilhaben. Die wenigsten Literaturkritiker*innen beanspruchen ja für sich, dass sie immer recht haben, mit dem, was sie schreiben. Der Gedanke ist wichtig, dass das eigene Urteil vielleicht auch nur vorläufig ist.
Es wird ja auch immer wieder die Frage nach den Grenzen der Kritik laut: Was darf sie oder ist sie gar tot? Gibt es in diesem Gespräch über Literatur eine Art Gesprächskultur?
Alle Kolleg*innen werden auf diese Frage etwas anderes sagen. 2012 gab es diesen Text im SPIEGEL zu Christian Kracht, von dem gesagt wurde, dass er die Grenzen der Kritik überschreite. Das finde ich schwierig. Man sollte keine Stoppschilder aufstellen, ich würde aber sagen, dass jede*r Kritiker*in selbst welche für sich aufstellen sollte. Eine Grenze sind für mich zum Beispiel Gefälligkeitsrezensionen über Autor*innen, die ich gut kenne oder mit denen ich womöglich befreundet bin. Da würde ich einfach meinem Urteil nicht mehr trauen. Oder, wie ich vorhin sagte, der Fairnessanspruch. Ich kann nicht wegen meiner, möglicherweise völlig bescheuerten Idiosynkrasien alle Berlin-Romane niedermachen.
Gibt es irgendeinen Berlin-Rroman, den du toll findest?
Wach von Albrecht Selge. Der ist wirklich toll.
Damit bringen wir das Berlin-Thema zu Ende und schauen noch mal auf die vermeintliche Konkurrenz: Wie ist deine Haltung zu Literaturblogs?
Ich empfinde Literaturblogs nicht als Konkurrenz und glaube, dass es Literaturkritik im Feuilleton und auf Literaturblogs geben kann, ohne da sofort einen Konflikt zu konstruieren. Wenn ausführlich über Literatur nicht nur gesprochen, sondern auch diskutiert wird, ist mir zunächst völlig egal, wo das stattfindet, solange die Diskussion interessant ist. Aber mir fällt an manchen Literaturblogs zum Beispiel auf, dass sehr wenig kritisiert und sehr viel einfach weggelobt wird. Und oft ist mir der Text zu kurz, als dass ich das Urteil nachvollziehen könnte. Aber das gilt ja nicht für den Literaturblog an sich. Was mir auffällt, sogar bei manchen prominenteren Blogs, ist so ein sonderbarer Affekt gegen das Feuilleton, aus dem ein gewisses Selbstbewusstsein gezogen wird. Ein bisschen wie: „Diese Feuilletons sind so altbacken und wir sind viel näher am Leser und haben das Internet auf unserer Seite.“ Da bin ich etwas ratlos, was das soll.
Auf der anderen Seite sagt man Kritiker*innen nach, sie würden selbst gerne literarisch schreiben. Hand aufs Herz, hast du ein Romanmanuskript in der Schublade liegen?
Nein. Da kann ich die Welt beruhigen.
David Hugendick, geboren 1980 in Bremerhaven, studierte Germanistik und Politikwissenschaft. Er ist Literaturredakteur von ZEIT ONLINE und lebt in Berlin.