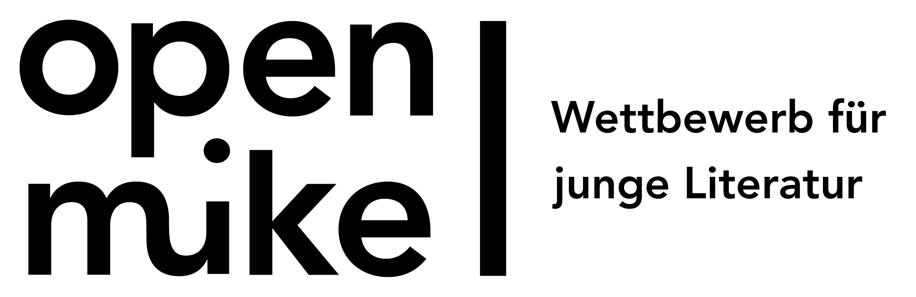In diesem Leben (Romanauszug)
AMIRA MORADI
Wir haben die Nacht vor uns. Lass uns damit beginnen: „Bald bin ich Licht, bald bin ich trüb, bald hart, bald weich, dann bös, dann gut. Bin Sonn und Vogel, Staub und Wind, so Mond als Kerze, so Strom wie Glut, bin arger Geist, bin Engelkind – Alles, alles ist gut.“
Weißt du noch? Als wir zum allerersten Mal zu zweit waren, habe ich dir diese Zeilen aufgesagt.
Wir saßen in der Wohnung meiner Eltern. Ich habe dir das Schreiben beibringen wollen. Mein Vater hat darauf bestanden, dass du es lernst. Du wolltest ihm nur einen Gefallen tun. „Warum soll ich meine Zeit mit Stift und Papier verschwenden?“, hast du mich gefragt.
Weißt du noch? Wir saßen Seite an Seite. Du hast dich über dieses große Heft gebeugt und hast versucht dein erstes Alef, Sin, Lam zu schreiben. Du konntest den Stift nicht richtig halten. Deine Buchstaben waren mehr Tintenflecken als Buchstaben. Ich habe deine Hand genommen und dir gezeigt, wie du Wellen, Kreise, gerade Linien formen kannst.
Dort hat es mit uns angefangen. Und hier endet es.
Wir haben nur noch diese eine Nacht. Wenn der neue Tag anbricht, werden wir beerdigt. Der Tod beginnt aber erst morgen. Heute Nacht sind wir zusammen.
Hakim!
Hör mir zu!
Heute Nacht möchte ich dir alles erklären!
Es begann mit meiner Geburt. Ich bin die Tochter einer Iranerin und eines Hazara aus Afghanistan.
Ich wurde als Halb-Iranerin geboren. Im Iran war ich aber keine. Das Land wollte mir keine Geburtsurkunde ausstellen. Ich hatte keinen Anspruch darauf. Nach dem Gesetz wurde ich nie geboren.
Solange ich im Leib meiner iranischen Mutter wuchs, hatte ich die gleichen Rechte wie sie. Nach der Entbindung wurden mir alle abgesprochen.
Die Nationalität kann alleine der Vater weitervererben. Und meinen Vater gab es nach dem Gesetz genauso wenig wie mich.
So wie andere Väter hat auch meiner vieles weitervererbt. Nur keinen legalen Aufenthaltsstatus. Seine Angst auch meine. Seine mandelförmigen Augen. Sein Mund. Seine Haare. Sein Volk. Meins.
Das einzige Dokument, mit dem ich meine Existenz hätte beweisen können, wäre meine Tazkira gewesen.
Für die Behörde war sie allerdings nichts wert.
Für mich umso mehr.
Meine Tazkira war eine gute Fälschung. Einer Polizeikontrolle bestand sie immer.
Und wenn das Glück von meiner Seite gewichen wäre?
Der Iran hätte meinen Vater und mich nach Afghanistan abgeschoben. Obwohl ich nie dort gewesen war!
Meine Mutter versuchte alles, um meine Dokumente zu ändern. Doch es half alles nichts.
Genau daran war sie gestorben.
An dem Tag, als ich zur Welt kam, erklärte ihre eigene Familie sie für tot. Sie hatte nicht nur einen Afghanen heimlich geheiratet. Sogar ein Kind hatte sie noch von ihm bekommen. Das reichte für ihre Beerdigung aus. Ihre Familie verscharrte sie für immer und suchte das Grab nie wieder auf. So floh meine Mutter aus ihrer Geburtsstadt Isfahan nach Teheran.
Ihre ganze Sippe löste sich von heute auf morgen in Luft auf. Mit der Sippe die Besuche. Die Freunde. Die Bekannten. Fortan hatte sie nur noch eine Tochter und einen afghanischen Mann.
Meine Mutter aber wollte ihr altes Leben mit uns weiterführen. Es war unmöglich!
Für ihre Familie gab es sie einfach nicht mehr.
Zum Glück hatte meine Mutter ein außerordentliches Verhandlungsgeschick. Ihr Glück war das unserer ganzen Familie. Wir mussten kein afghanisches Leben führen.
Meine Mutter hatte eine Geschäftsidee. Aus ihrer Idee wurde bald Realität.
Meine Eltern eröffneten ihre eigene Autowerkstatt.
Später bekam meine Mutter ein zweites Kind. Meinen Bruder Amirjan. Auf einen Schlag hatte sie keine Zeit mehr. Mein Bruder lernte weder sprechen noch laufen. Sie musste sich immer um Amirjan kümmern.
Da war die Werkstatt schon ein Selbstläufer. Sie brachte gutes Geld ein.
Wir hatten alles, was wir brauchten.
Ich musste nicht zur Arbeit.
Meine Mutter hätte es nicht ertragen.
Dass ich zur Schule gehe, war für sie sehr wichtig.
Bevor sie meinen Vater kennengelernt hatte, war sie Lehrerin gewesen. Nach dem Umzug von Isfahan nach Teheran unterrichtete sie nie wieder in einer Schule. Trotzdem gab sie ihren Beruf nie auf.
Auf eigene Faust versuchte sie den Kindern unseres Viertels das Schreiben und Lesen beizubringen. Manche kamen öfters. Irgendwann blieben sie alle weg. Eine Handvoll Buchstaben haben sie trotzdem gelernt. Manch andere kamen nie.
Mich selbst schickte sie in eine normale Schule in die Stadt. Wenn sie nicht darauf bestanden hätte, wäre ich eine andere Person geworden. Ich habe den Tag, als es passierte immer noch vor Augen:
Ich bin vierzehn Jahre alt. Der Tag beginnt mit einer Lesestunde. Wir müssen aus einem Buch laut vorlesen. Danach mit eigenen Worten erzählen, was wir von dem Text verstanden haben.
Im Lesen bin ich gut. Jeden Tag habe ich mit meiner Mutter zusätzlichen Unterricht.
Manche aus meiner Klasse mögen mich nicht. Sie sagen zu mir: „Streberin“. Meine Freundinnen, Shahin und Nilofar sagen: Ich bin die beste in der Klasse und darauf sollte ich stolz sein.
Nachdem wir den ersten Text fertig gelesen haben, fragt die Lehrerin: „Wer will mit dem zweiten Text beginnen?“
Ich melde mich freiwillig. Ich lese den Text.
Von der Lehrerin bekomme ich Lob.
Ich bin glücklich.
Später haben wir Naturkundeunterricht. Nach Naturkunde eine kurze Pause. Dann Mathematik. Mathematik ist mein Lieblingsfach.
Ich sitze mit Shahin und Nilofar zusammen. Für sie ist das Zahlenwerk ein Schreck. Ich verstehe nicht warum.
Nach Mathematik haben wir Mittagspause. Ich gehe mit meinen Freundinnen in den Hof. Sie fragen mich, ob ich helfen kann. Sie haben vom Unterricht nichts verstanden. Ich erkläre ihnen die Aufgaben. Jede einzeln.
Nicht nur heute. Oft fragen mich meine Freundinnen, ob ich ihnen helfen kann. Ich mache es gerne.
Meine Mutter meint: Wenn ich Lehrerin werden möchte, ist es eine gute Übung für mich. Anderen etwas erklären zu können, braucht viel Übung. Dabei sei es nicht wichtig, ob es um Mathematik oder etwas anderes geht. Wichtig sei, dass ich immer geduldig und aufmerksam bleibe. Eine gute Lehrerin sei erst eine gute Lehrerin, wenn sie wirklich zuhören kann.
Ich glaube, dass meine Mutter recht hat.
Seitdem ich Shahin und Nilofar bei Mathematik helfe, sind sie besser. Nicht viel besser, aber ein bisschen.
Ich blicke von meinem Heft auf und sehe, Hanum Haydari läuft über den Schulhof. Sie kommt direkt zu uns. Sahin und Nilofar halten ihre Bücher in der Hand. Sie bemerken die Lehrerin erst, als sie schon vor uns steht.
Hanum Haydari fragt mich: „Hilfst du deinen Freundinnen?“ „Ja, wir lösen Mathematikaufgaben…“. „Das machst du öfter, nicht wahr?“ „Ja! Ich mache es gerne! Ich möchte Lehrerin werden, wie meine Mutter!“
Hanum Haydari ist plötzlich still. Ich denke, vielleicht habe ich etwas Falsches gesagt. Ich weiß aber nicht was.
Hanum Haydari schickt Shahin und Nilofar wieder in die Klasse. Sie möchte mit mir alleine reden. Jetzt bin ich mir sicher, ich habe etwas Falsches gesagt.
Shahin und Nilofar gehen. Ich bleibe mit Hanum Haydari alleine. Sie setzt sich neben mich: „Von deiner Sorte gibt es schon zu viele in diesem Land. Was bildest du dir ein? Glaube nicht, dass du Lehrerin werden kannst! Du wirst es nämlich nie!“
Was habe ich verbrochen?
Hanum Haydari steht auf und geht, ohne mir noch ein Wort zu sagen. Ich verstehe nicht, warum sie mir so etwas sagt.
Nach der Schule fahre ich nach Hause und erzähle meiner Mutter, was mir zugestoßen ist. Sie regt sich auf und flucht. Bald kommt mein Vater und fragt, was passiert ist. Dann erzählt ihm meine Mutter, was ich ihr erzählt habe. Mein Vater schaut mich an: „Du darfst dich nie einschüchtern lassen! Verstehst du? Nie!“
Dieser Tag löste etwas in mir aus. Was es genau war, kann ich nicht sagen. Ich kann mich nur noch daran erinnern, dass ich mich auf einmal anders fühlte.
Ich wollte nicht mehr in die Schule.
Für meine Mutter kam so etwas nicht in Frage. Mein Vater sah es etwas anders.
Er meinte, meine Mutter habe keine Ahnung davon, wie es wirklich war, mit einem Hazara-Gesicht im Iran herumzulaufen.
Meine Mutter war plötzlich böse mit meinem Vater.
Sie sagte, sie wisse genau, was es bedeute mit einem Hazara-Gesicht verheiratet zu sein. Damit hatte sie die Diskussion für beendet erklärt.
Meine Mutter ließ sich weder von meinem Vater noch von mir überzeugen. Sie beharrte darauf, dass ich weiterhin die Schule besuchte. Das war ihr Schlusswort.
Von nun an hatte ich das Gefühl, dass mein Vater und ich etwas teilten, an dem meine Mutter nie würde teilhaben können.
Meine Eltern hatten für mich keinen Kopf. Sie waren sehr beschäftigt. Es hatte sich eine vielversprechende Möglichkeit für meinen Bruder aufgetan.
Der Arzt, den meine Mutter und mein Bruder regelmäßig besuchten, behauptete: Mit einer aufwendigen und teuren Operation könnte er meinen Bruder heilen. Wenn alles nach Plan verliefe, würde er ganz ohne Hilfe laufen können. Vielleicht könnte er auch sprechen. Das Letztere war mehr eine wage Behauptung, statt ein Versprechen.
Meine Eltern waren Feuer und Flamme. Sie redeten ständig davon, wie es wohl wäre, wenn meinen Bruder wirklich geheilt werden könnte.
Mein Vater versuchte, das Geld für die Operation zusammenzukriegen. Er arbeitete Tag und Nacht.
Meiner Mutter lief mit meinen Bruder von Praxis zu Praxis, um alle nötigen Voruntersuchungen zu absolvieren.
Ich kann mich nicht mehr genau erinnern, ob es Wochen oder Monate waren. Im Rückblick erscheint es mir so, als ob meine Eltern jahrelang abwesend gewesen wären.
Dann plötzlich nahm alles ein Ende.
Wie aus heiterem Himmel.
Wir saßen beim Abendessen zusammen. Mein Vater verkündete, dass die Operation meines Bruders verschoben werden müsse. Er konnte das nötige Geld einfach nicht aufbringen.
Während meine Eltern sich um meinen Bruder kümmerten, wurde ich krank. Ich hatte Magenschmerzen und verlor immer mehr den Appetit. Fühlte mich müde. Konnte mich auf nichts und niemand konzentrieren.
Irgendwann hatte ich nicht mehr die Kraft, in die Schule zu gehen. Meine Mutter wollte es nicht akzeptieren. „Du muss unbedingt hin…!“ Ich konnte trotzdem nicht.
Ich verbrachte meine Tage liegend im Bett. Manchmal stand ich auf, um auf die Toilette zu gehen. Danach legte ich mich wieder hin.
Ich war irgendwo angekommen, wo ich nie zuvor in meinem ganzen Leben gewesen war.
Meine Mutter war wütend auf mich.
Sie hielt meine Niedergeschlagenheit für einen hartnäckig gespielten Protest gegen die Schule.
Ich versuchte, ihr zu erklären, dass es nicht so war. Sie glaubte mir nicht.
Dann sagte ich ihr nichts mehr.
So vergingen Wochen.
Ich lag nur noch im Bett.
Dann, eines Tages, kam mein Vater in mein Zimmer. Ich weiß noch genau, wie es war:
Mein Vater kniet sich neben mein Bett. „Amira! Hörst du mich?“, flüstert er. Ich höre ihn ganz klar. Antworten kann ich ihm nicht. Die Wörter bleiben mir im Hals stecken.
„Amira! Komm! Bitte komm…“ Er nimmt meine Hand und will mich mit ins Wohnzimmer nehmen. Ich wehre mich nicht. Er trägt mich in den Armen, wie er immer meinen Bruder trägt.
Er geht mit mir ins Wohnzimmer.
Dort sitzen meine Mutter und Amirjan. In dem Moment, als mein Vater den Raum betritt, spielen sie mit Holzklötzen.
Meine Mutter sitzt auf dem Boden und stapelt die Klötze aufeinander. Sie baut einen Turm. Mein Bruder zerstört ihn laut schreiend. Danach baut sie einen neuen Turm.
Mein Vater setzt mich zu ihnen. Dann geht er weg.
Auch meine Mutter geht.
Ich bleibe mit Amirjan alleine.
Er schaut mich an und zeigt auf seine Bauklötze. Er will, dass ich genauso wie Mutter einen Turm baue. Ich sitze da und fühle mich wie gelähmt. Amirjan verzieht das Gesicht und presst die Lippen zusammen. Er weint. Ich beginne, die Holzklötze aufeinander zu stapeln.
Auf einmal schlägt sein Gemüt um. Er lächelt wieder und wirft den Turm mit einer einzigen Handbewegung um. Ich stapele die Holzklötze wieder aufeinander und merke, dass es mir dabei etwas besser geht.