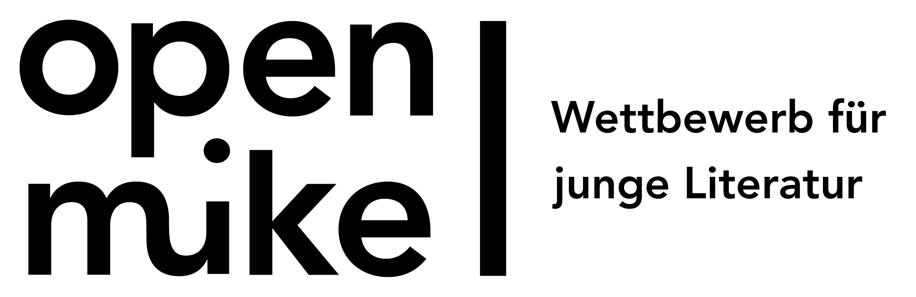Drei Preise vergab die open mike-Jury, einen die taz-Pubikumsjury. Ihre Auswahl begründeten sie so:
taz-Publikumspreis

Es war keine einfache Entscheidungsfindung, wir haben uns lange beraten. Wir hätten uns tatsächlich gefreut, wenn bei den 20 Texten ein schlechter dabei gewesen wäre, das hätte es einfacher gemacht. War aber nicht: Alle 20 Texte waren wirklich toll.
Die Texte haben ganz unterschiedliches mit uns gemacht, haben uns zum Lachen gebracht, uns irritiert, Ekel erregt oder uns fast zum Heulen gebracht.
Aber nun zum Gewinnertext. Wir wollten einen Text, der nicht zu glatt ist. Einen Text, über den wir diskutieren können und müssen. Der ein Geheimnis hat, das auch nicht ganz geklärt wird. Einen facettenreichen Text, der nicht an der Oberfläche bleibt, sondern hinter die Fassade schaut. Der vielfältige Bezugsräume eröffnet, Erwartungen unterläuft, überraschend wie überzeugend ist.
Wir haben ja fünf lyrische Texte gehört, die diesen Kriterien gefolgt sind. Nicht alle waren so, wie man ein typisches Gedicht erwartet. Beim Gewinnertext fragten wir uns: »Was geht hier vor?« Was uns besonders gefallen hat, war, dass der Text viele verschiedene Bezüge hat, etwa auf Märchen, Popmusik, Mythologie und auf neue, alte und sehr alte Literatur. Uns hat weiter gefallen, dass der Text so weiblich war, so körperlich, so fleischig. Man konnte geradezu den Uhu rufen, den Fisch glitschen hören, und er hatte einfach eine unglaubliche Saftigkeit. Und damit wissen nun auch alle, wer gemeint ist: Der Preis der 11. taz-Publikumsjury geht an Caren Jeß für die Ballade von Schloss Blutenburg.
Preise des 26. open mike
Laudatio von Steffen Popp auf Lara Rüter


Hier geht’s in die Vertikale, durch die drei Hirnhäute zum Beispiel, eine gespannte, körpernahe Bewegung, die Gewissheiten des Textes und der Sprache mit zunehmender Tiefe auflöst. Wer ist hier das Fossil? Man selbst? Oder der Text, der sich selbst durchaus archaisch gebärdet und als Anachronismus in den Blick nimmt? Ist es vielleicht von Vorteil, Fossil zu sein? Man liegt in dichten Schichten, Blutgruppe A Rhesus+, zwischen Müll, den Helikoptern, die ihn herantrugen, Tomaten-Pingpong und Mary Shelley’s Kniestrumpf, erst immerhin noch in Museen und etikettiert, am Ende vom eigenen Körper verlassen, was immer der einmal war oder bedeutet hat. Die Texte unternehmen Expeditionen zwischen diesen beiden posthumen, vielleicht auch posthumanen Zuständen und führen – paradox genug – dabei sehr ins Lebendige. Nicht zuletzt deshalb, weil sie selbst lebendig sind, weil die Sprache – anachronistisch, untot – in jedem Wort funkelt und sprüht. »Heb’ ich dich also an«, fragt Lara Rüter, »wer sagt, dass du darunter lebst?«
Laudatio von Katja Lange-Müller auf Yade Yasemin Önder

Subtil loben und dann auch noch halbwegs auf dem Niveau des auserkorenen Textes, das ist schwierig. Und so hoffe ich, dass ich die in ziemlicher Eile auf diesen Zettel geworfenen Sätze einigermaßen entwirrt vorlesen kann. Wenn ich gewusst hätte, dass die taz es so spannend macht, hätte ich natürlich alles nochmal abschreiben können.
Lakonie, Zorn und grimmiger Witz, abwechselnd und doch in Symbiose. Der von uns erwählte Text transformiert katastrophische Realität zu literarischer Energie. Der Leser/Zuhörer wird von Wort zu Wort wacher und bald seltsam fröhlich. Denn dieser Text weiß, das Absurde ist immer schon da, es muss nicht erst aufwändig erzeugt werden. Er tanzt auch mit eingeschobenen Nebensätzen, jeder Satz, jedes Wort überrascht, was einerseits von der aufgebrochenen Syntax herrührt, andererseits davon, dass er manchmal kurz stoppt und an sich an den Leser/Zuhörer wendet. So entsteht ein eigenwillig sprunghafter Rhythmus, eine sich ganz bewusst selbst ins Wort fallende Erzählweise, die Salamipizza und Hannelore Kohl zusammenbringt, und die man wohl Prosa nennen kann, im Sinne dessen, was Lektor Jan Valk zu Yade Önder sagte: »Dieser Text zeigt, dass Prosa die freieste Form ist« –und die befreiende auch, wie die Jury dringend hinzufügen will.
Laudatio von Steffen Popp auf Kyrill Constantinides Tank


Der Umstand, dass ich hier nochmal am Pult stehe, lässt vielleicht etwas erahnen. Ich mache auch kein Geheimnis um den Text, wie es uns aufgetragen war und steige direkt voll ein, »Siri / wie weh tut eine Mausefalle?«. Auch wenn die Zeile nur einmal vorkommt, diese Texte fragen im Grunde immer danach, was man zu ertragen bereit ist.
»faxen, abrackern, abraxas / Schussfreiezone«, das sind zugleich Selbstbeschreibungen, konzentrierte Parforce-Ritte durch sprachliche und gestische Register, die einen bis zur letzten Zeile wach und immer wieder perplex und in Begeisterung halten. Auch wenn man oft genug aus diesen Zuständen hinaus und auf sich selbst berufen wird. Muss man alles auf Anhieb verstehen?
Logisch auf keinen Fall, aber auf Anhieb in eine Art Sparring mit Sätzen und Satzzerstörung, Bilder und Bildverstörung treten. Keinen Moment ausruhen und am Ende gleich nochmal zu lesen beginnen, auch – aber nicht nur – »um Ulm herum« und »by the way«, wird eine Lanze gebrochen für Dialekt im Gedicht.
Es sind die Gedichte von Kyrill Constantitides Tank, dem diese Eloge der Jury gebührt.