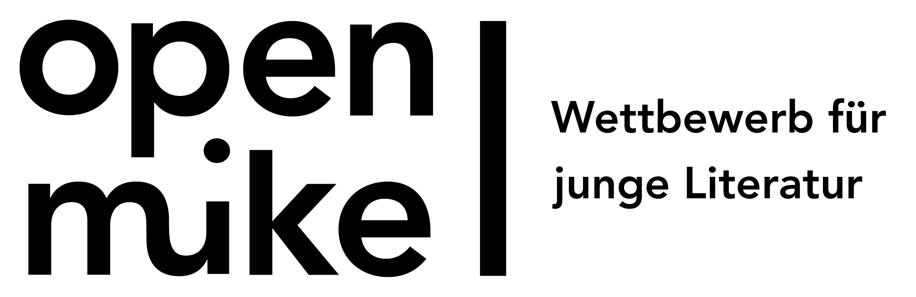„So geben sich die Wellen am Ufer die Hand, weiter und weiter und.“ Dieser Satz spiegelt den Stil des Textes: Wie die Wellen des Meeres geben sich auch die Sätze die Hand, fließen ineinander und irgendwann hört es dann auf. Das Meer ist hier die Hauptfigur, entwickelt eine Persönlichkeit, ist launisch.
Die Erzählerin (oder der Erzähler?) nimmt eine Stelle als „Alltagsassistenz“ an, „keine Ausbildung erforderlich“. Sie pflegt eine Person, die offensichtlich eingeschränkt ist und am Meer lebt, und so werden der Alltagsassistentin Dinge unselbstverständlich, die immer selbstverständlich waren. Es entsteht ein neues Körperbewusstsein:
Seit ich – durch dich – erlebe, was Leben auch bedeuten kann, beobachte ich mehr und mehr Abläufe und Funktionen des Körpers, die, einmal als Kind erlernt und perfektioniert, dem gesunden Menschen gar nicht mehr auffallen. Die linke Hand wirft die Autotür zu, die rechte sperrt sie ab.
Man fragt sich, wer diese Person überhaupt ist, es bleibt alles sehr vage und davon lebt diese Geschichte. Vom Verwischen der Grenzen zwischen der Person, die sich kümmert und der, um die sich gekümmert wird. Bis dann alles noch einmal kippt und auf einmal der Eindruck entsteht, dass die zweite Person vielleicht immer schon das Meer war: „Heute bist du wild. Drängst ans Land. Unaufhörlich“. In der Anrede des Meeres wird der Text plötzlich sehr politisch, das Meer wird als Schauplatz und Friedhof der Flüchtlingskrise erkennbar:
Es ist Abend geworden, und du wieder wild. Zeigst deine Kraft. In der Wildnis deiner Weite möcht ich verloren gehen. Ist das nicht zynisch, das heute zu sagen, mit Gedanken zu einem anderen Meer, das eingebettet liegt zwischen den unü̈berwindbaren Mauern von Europa auf der einen Seite – die Sicherheit und der Wohlstand gut geschützt und abgeschirmt – und den brennenden Ländern der südlichen Kontinente auf der anderen Seite. Ja, das Wasser, das zu einer zweiten Mauer geworden zu sein scheint. Und mit Booten ist es schwer, ü̈ber Mauern zu gelangen. Dich hier vor mir nennen wir Atlantik.
Lena Rubey traut sich an eine Auseinandersetzung mit dem größten politischen und menschlichen Problem unserer Tage heran und nähert sich dabei nicht frontal, sondern von der Seite. Über das Meer. Sie schreibt über einen Sehnsuchtsort, der zur Hölle wurde, und wenn man literarisch über dieses Grauen schreiben will, dann vielleicht so.